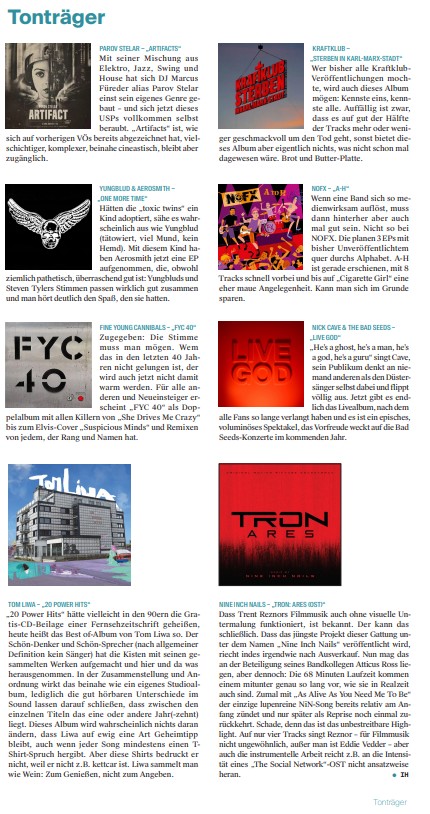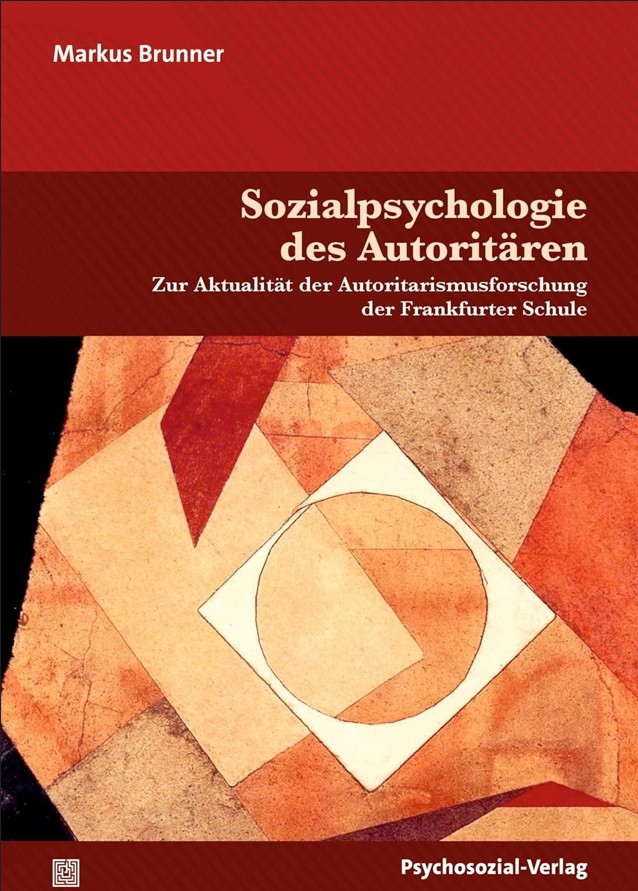Mensch Xavier,
da biste ja wieder. Der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Gut, vielleicht nicht alle. Aber die meisten! Also bestimmt der eine oder andere … wurscht, du bist zurück. Aber dass du dir ausgerechnet Köln ausgesucht hast für diesen Aufschlag – Berlin wäre doch viel passender gewesen. Im Reichstag! Schade auch, dass die Krolloper nicht mehr steht. Wie man hört, ließ es sich dort früher vortrefflich Heimatlieder schmettern. Machst du natürlich alles nicht mehr.
Du warst, wie du selbst sagtest, zwischenzeitlich vom Weg abgekommen, verblendet und was nicht noch alles. Deshalb hast du auch Dinge gesagt und getan, für die du dich heute schämst. Nicht ganz zu Unrecht! Sowohl Corona als auch den Holocaust zu leugnen … tja nun, das war vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ein ganz kleines bisschen. Aber man muss auch mal Gras über so eine Sache wachsen lassen. Nein, Xavier, nicht dieses Gras. Obwohl, wenn‘s hilft, dann bitte.
Wo waren wir? Gras, ach ja. Die Menschen vergessen schnell. Vor gerade mal 28 Jahren hat irgend so ein Heini gemeint, Vergewaltigung innerhalb einer Ehe sei etwas gänzlich anderes als außerhalb einer Ehe und müsse deshalb nicht bestraft werden. Und stell dir vor: Genau diesen Heini hat man jetzt zum Kanzler gemacht. Kannste dir nicht ausdenken, so was. So schnell vergessen die Menschen! Damit wollten wir jetzt nicht sagen, dass du mit deinem Comeback bitte noch 23 Jahre warten sollst; wobei, doch, eigentlich schon. Sowohl wir finden das als auch bestimmt die „sogenannten Juden“, die du beleidigt hast, aber das muss man ja nicht so grob formulieren. Eher so: Dieser Weg wurde dir wirklich leicht gemacht, er hätte steiniger und schwerer sein sollen, um dich mal zu zitieren.
Da hast du ganz schön Glück gehabt. Andererseits, das wirst du uns zugestehen, fällt es schwer, an Koinzidenz zu glauben: Das Land befindet sich in … na ja … diesem Zustand und da kommt ein wegen Volksverhetzung angeklagter Popsänger aus der Versenkung und – aber ja, entschuldige, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Du hast natürlich völlig Recht, man muss Werk und Künstler voneinander trennen. Das haben wir von Morrissey und Roger Waters auch schon so gehört. Habt ihr Drei euch ja fein ausgedacht in eurem Antisemitismus-Club! Nur, Xavier, ist es doch so: Du hast früher mal schöne Lieder geschrieben (und wenn du uns ein bisschen Zeit gibst, fällt uns bestimmt auch eins ein) und danach hast du dann doofe Sachen gesagt. Damit trennen wir doch ganz eindeutig Werk und Künstler. Das schöne Lied (dieses eine, Moment noch, gleich haben wir‘s) geht in Ordnung, wir finden aber nicht, dass wir 60 Euro aufwärts von unserem schwer verdienten Geld ausgeben sollten, bloß damit du im emotionalen Überschwang den Großen Diktator geben kannst.
Aber wir wollen nicht ganz so unversöhnlich enden. Denn weißt du, was wir richtig, richtig gut von dir finden? Dass du dich in Köln um die Sache mit dem Stadtbild kümmerst, die der Kasper (s.o.) da neulich angestoßen hat. Alle Krachlatten, die sonst frei rumlaufen würden, sind nämlich bei dir in der Lanxess Arena. Davor ziehen wir unseren Aluhut und sagen herzlichen Dank, deine Stadtkinder.